Ostern vor zwei Jahren. Ich saß weinend im Sandkasten. Nicht mein Kind. Ich. Mit Tränen in den Augen und einer riesigen Enttäuschung im Herzen. Um mich herum tobten meine Kinder, völlig überdreht von Schokolade, Geschenken und der allgemeinen Aufregung. Und ich? Ich war einfach nur leer. Erschöpft. Wütend. Traurig.
Dabei hatte ich mich doch so auf dieses Fest gefreut.
Das große Osterfiasko
Die Tage zuvor hatte ich im Akkord gearbeitet: aufräumen, putzen, einkaufen, backen, kochen, Geschenke besorgen – nicht nur für unsere Kinder, sondern auch im Auftrag von Großeltern und Urgroßeltern. Natürlich hübsch eingepackt und bereit zum Verstecken am Ostersonntag.
Ich tat das alles gerne. Wirklich. Ich hatte ein Bild im Kopf, wie schön das Fest werden würde. Die Kinder, wie sie mit leuchtenden Augen ihre neuen Fahrräder ausprobieren. Die Familie, wie sie lachend im Garten sitzt, ein gutes Stück Hefezopf in der Hand, ein Glas Sekt in der anderen. Sonnenschein, Harmonie, Wärme.
Und dann?
Niemand kümmerte sich um die Kinder. Stattdessen sprang ich zwischen Küche, Wohnzimmer und Garten hin und her – versuchte, allen gerecht zu werden. Mein liebevoll gebackener Hefezopf blieb unangerührt. Der mitgebrachte Supermarktkuchen wurde bevorzugt. Und ich? Ich verschwand irgendwann einfach in den Sandkasten – zu meinen Kindern. Und weinte.
Warum tut das so weh?
In diesem Moment wurde mir etwas klar: Ich war nicht nur erschöpft – ich war zutiefst enttäuscht. Von meiner Familie. Vom Fest. Von mir selbst. Ich hatte Erwartungen gehabt, so viele Hoffnungen in diesen Tag gelegt – und sie waren einfach verpufft.
Heute weiß ich: Enttäuschung entsteht, wenn Erwartungen nicht mit der Realität übereinstimmen. Und meine Erwartungen hatten auf einem Fundament gebaut, das nie tragfähig war.
Denn wenn Großeltern sich sonst auch schwer damit tun, sich mit ihren Enkeln zu beschäftigen – warum sollte sich das plötzlich an Ostern ändern? Wenn „Gast sein“ in manchen Familien bedeutet, sich eben nicht aktiv zu beteiligen – warum sollte sich diese Haltung bei uns plötzlich ändern?
Der unsichtbare Druck
Und der größte Irrtum: Ich glaubte, ich müsste alles perfekt machen. Dass ich nur dann liebenswert bin, wenn das Haus glänzt, das Essen perfekt schmeckt und jeder sich wohlfühlt. Dass meine Leistung meine Anerkennung bestimmt.
Aber niemand hatte mich darum gebeten. Niemand hatte von mir erwartet, dass ich mich aufopfere. Dieser Druck kam von mir selbst. Weil ich gelernt hatte, dass ich „nur dann genug bin“, wenn ich alles gebe. Doch die traurige Wahrheit war: Wenn diese Anerkennung ausblieb, fiel ich in ein Loch. Wurde wütend. Enttäuscht.
Dabei tat ich all diese Dinge – nicht für die anderen. Sondern für mich. Für mein Bild vom perfekten Fest. Für meine Vorstellung von Familie. Für mein Bedürfnis nach Anerkennung.
Was ich heute anders mache
Heute frage ich mich: Was ist uns als Familie wirklich wichtig? Was brauchen wir für ein schönes Fest? Welche Rituale tun uns gut?
Die Antwort ist oft viel einfacher als gedacht.
Wir feiern Ostern inzwischen alleine. Ohne großes Tamtam. Kein Stress, keine Verpflichtungen. Wir backen gemeinsam Quarkhasen, essen sie den ganzen Tag lang. Am Abend gehen wir zum Osterfeuer. Das war’s. Und ich war noch nie zufriedener.
Fazit: Weniger Perfektion, mehr Wirklichkeit
Feiertage haben so viel Potenzial. Für Gemeinschaft, Wärme, schöne Erinnerungen. Aber sie können auch ganz schnell kippen – wenn wir uns selbst verlieren in unseren Erwartungen.
Ich habe gelernt, meine Vorstellungen regelmäßig einem Realitätscheck zu unterziehen. Mir zu erlauben, nicht perfekt zu sein. Und mir selbst die Anerkennung zu geben, die ich früher im Außen gesucht habe.
Denn das, was zählt, ist nicht der perfekt gedeckte Tisch. Es ist das ehrliche Lachen. Die Ruhe. Die Nähe. Und die Freiheit, ein Fest zu feiern, das wirklich zu uns passt.
Ich wünsche euch frohe Ostern. Nicht perfekt für andere – sondern genau richtig für euch.
Alles Liebe,
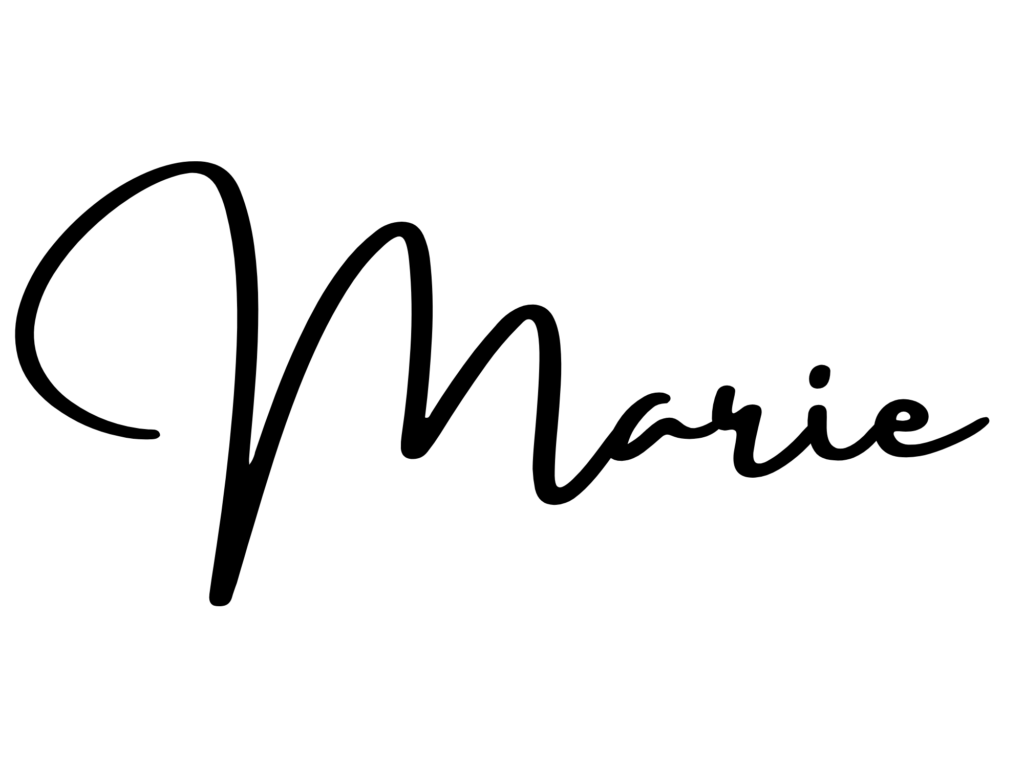





Schreibe einen Kommentar